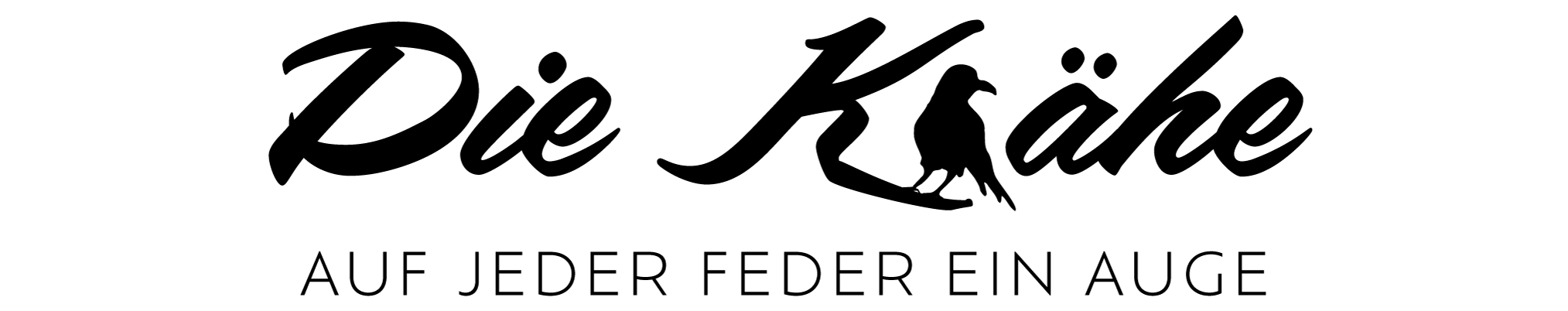Britischer Journalist Richard Medhurst von österreichischer Polizei verhaftet
von Liza Ulitzka
Nur unter sehr schwierigen Bedingungen konnte er das Video aufnehmen, erzählt Richard Medhurst in dem Video über seine Verhaftung auf Twitter und Youtube. Denn die österreichische Polizei hätte ihm bei einer Hausdurchsuchung alle seine elektronischen Geräte abgenommen. Er sei praktisch arbeitsunfähig, sagt er.
Die Einwanderungsbehörde hätte ihn geladen, weil es offene Fragen wegen seiner Aufenthaltsgenehmigung gab. Er sei der Ladung ohne Befürchtungen gefolgt, weil er schon lange in Österreich lebe und nie Probleme gehabt hätte. Doch nach ein paar Fragen hätten die Beamten plötzlich gesagt, dass sie darüber nachdenken würden, ihm den Aufenthaltstitel zu entziehen, wegen seiner Berichterstattung über Palästina und Libanon. Plötzlich sei eine Reihe von Polizisten in zivil in den Raum gekommen. Sie hätten ihm ihre Dienstausweise gezeigt und gemeint, sie wären das Pendant zum britischen Geheimdienst MI5. Sie verhafteten ihn und zeigten ihm auch einen Durchsuchungsbefehl für seine Wohnung. „Weil sie meinen, dass ich, ein britischer Christ, ein Mitglied der Hamas bin“, erzählt Medhurst fassungslos. „Sie meinen, ich bin ein Mitglied der al-Qassam-Brigaden, würde Propaganda verbreiten, zum Terrorismus aufrufen und hätte Verbindungen zum organisierten Verbrechen.“ Sie fuhren mit ihm zu seiner Wohnung, durchsuchten sie und sein Aufnahmestudio, wo sie „alle elektronischen Geräte vor meinen Augen zerlegt haben.“ Medhurst ist überzeugt davon, dass das in Zusammenhang mit seiner Verhaftung in London-Heathrow vergangenen August steht. Doch laut ihm verneinten die Beamten das. Stattdessen forderten sie die Passwörter für seine Geräte, was er verweigerte, um seine Quellen zu schützen. „Ich widerspreche kategorisch all diesen Anschuldigungen der österreichischen und der britischen Regierung. Ich bin kein Terrorist, ich bin eine Journalist.“
Die Krähe wird weiter über den Fall berichten. Hier können Sie unseren Artikel vom Dezember 2024 nachlesen, in dem Dieter Reinisch über Richard Medhursts Verhaftung in London-Heathrow berichtete.
Quellen:
Video über seine Verhaftung:
https://www.youtube.com/watch?v=nKQeOqzqu6w
Artikel über Medhurst aus der Dezember-Ausgabe
Der Schuld-Kult
Essay von Liza Ulitzka
Greta Thunberg, die Jeanne d’Arc der Fridays For Future-Klima-Bewegung, ist einen Schritt zu weit gegangen. Erst rief sie zum Generalstreik für Gaza auf. Wenig später veröffentlicht Fridays For Future International einen medienpolitischen Beitrag auf der Online-Plattform Instagram. Das Posting, das inzwischen gelöscht wurde, bezeichnete die westliche Medienberichterstattung über den neu aufgeflammten Krieg zwischen Israelis und Palästinensern als Gehirnwäsche. „Es gibt keine zwei Seiten. Der eine ist der Unterdrücker, der andere der Unterdrückte“, zitiert die Kronen Zeitung aus dem Posting. „Die Medien“ würden das verschweigen und nicht die ganze Geschichte erzählen. Westliche Medien seien nicht unabhängig, sondern wären von imperialistischen Regierungen gegründet worden, die an der Seite Israels stehen, nicht um der Menschheit willen, sondern um ihrer selbst willen. Die Kronen Zeitung leitete ihren Artikel über das FFF-Posting folgendermaßen ein: „Die Klimabewegung Fridays for Future hat über einen ihrer Accounts antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet. Das Posting bildet den bisherigen Höhepunkt des Judenhasses, der in Teilen der Gruppierung offenbar überhandnimmt.“ Weiter unten schreibt die Kronen Zeitung, in dem FFF-Posting „werden Fakten verdreht und Hass geschürt“ und es würde eine „israelische Weltverschwörung der Medien nahegelegt“.
Was macht einen Kult aus, in unserem Fall den „Schuld-Kult“? Ein Kult braucht ein Objekt oder eine Gottheit zur Anbetung. Ein Kult folgt Ritualen, Handlungen, die in bestimmten periodischen Abständen immer wiederholt werden. Ein Kult sollte von seinen Gefolgsleuten nicht hinterfragt werden. Nun also zum „Schuld-Kult“: Wenn es um Kritik an Israel geht, dann gibt es die immergleichen Reaktionen darauf, womit wir beim Ritual wären. Im Fall des FFF-Postings werfen die Medien den Urhebern „Judenhass“ vor. Mit keinem Wort wird in dem Posting der Hass auf Juden propagiert. Es ist eine schlichte Tatsache, dass der Staat Israel seit seiner Gründung Palästinenser ermordet, unterdrückt und gängelt. Die Palästinenser sind den Juden in Israel in allen Sphären des Lebens untergeordnet. Diese Tatsache zu benennen, hat nichts mit Judenhass zu tun, es ist traurige Realität. Es ist in dem Posting auch keine Rede davon, dass Juden an sich minderwärtig wären oder, wenn man nach der Definition für Antisemitismus nach der deutschen Bundeszentrale für politische Bildung geht, „die Existenz der Juden als Ursache für alle Probleme“ genannt wird. Das Wort „Jude“ fällt nicht ein Mal. Ebensowenig wird eine „israelische Weltverschwörung der Medien“ nahgelegt. Es ist zwar falsch zu behaupten, die Medien wurden alle von Regierungen gegründet, denn Medien wurden und werden in der westlichen Welt fast ausschließlich von privaten Unternehmern gegründet, oft von Journalisten selbst. Dass Medien mit wachsendem Erfolg und Reichweite allerdings zu einem Objekt der Begierde für politische Parteien und große Unternehmen werden und ihre Ideale schnell einmal über Board werfen, wenn der Betrag stimmt, ist kein Geheimnis. In Österreich wurde der Korruptionssumpf rund um Politik und Medien nicht zuletzt durch die Ibiza-Enthüllungen erneut vor Augen geführt. Besonders viel Einfluss üben die jeweils Regierenden aus, weil sie über die staatlichen Werbebudgets verfügen, die sie je nach Willfährigkeit der Berichterstattung verteilen können. Auch das ist Message Control. Politisch und wirschaftlich unabhängigen Journalismus gibt es in den etablierten Medien nicht. Wenn die Staatsraison von Washington bis Paris „We stand with Israel – Wir stehen hinter Israel“ lautet, dann wird diese Losung auch von den Medien so transportiert – das ist eine täglich zu beobachtende Tatsache und kein Antisemitismus.
Zum Kult-Objekt degradiert
Dass jegliche Kritik an Israel und an den Medien reflexartig in den Antisemitismus-Rahmen gequetscht wird, sehe ich als Folge des Schuld-Kults. Österreichs und Deutschlands Schuld am Holocaust wurde zum Kult-Objekt degradiert. Ich sage degradiert, weil wir durch das Stellen des Holocaust in einen historischen Schrein des einzigartig Bösen taub und blind für das Leid anderer geworden sind und so auch nicht mehr den Opfern des Nationalsozialismus gerecht werden. „Niemals vergessen“, „Wir tragen Verantwortung“, „Ein einzigartiges Verbrechen,“ „grassierender Antisemitismus“ – Politik, Medien, wir alle leiern diese zu leeren Chitin-Panzern gewordenen Floskeln herunter und merken nicht, wie der Schuld-Kult schichtweise die Empathie in uns abträgt. Die Empathie sowohl für die Opfer des Nationalsozialismus als auch für die Opfer anderer Gräueltaten auf der Welt. Damit tun wir niemandem einen Gefallen. Im Gegenteil: Die Schuld am Holocaust wird so zu einem Machtinstrument: „Du musst dich schuldig fühlen und zu Israel stehen oder du bist ein Antisemit!“ Wer tut schon aus Überzeugung das, was er muss? Der Schuld-Kult wirbelt wie ein Sandsturm durch die öffentliche Debatte und lähmt jegliches kritische Denken. Daraus folgt, dass historische Tatsachen negiert oder verschwiegen werden oder das Wissen darüber schlicht nicht vorhanden ist. „Das ist zu kompliziert, da kenne ich mich nicht aus“ heißt es oft, wenn unter Freunden oder Kollegen die Sprache auf den Nahost-Konflikt kommt. Einerseits haben die Menschen Angst davor, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil die Antisemitismus-Falle schnell zuschnappen kann. Andererseits wird über die Menschenrechtsverletzungen, die seit Jahrzehnten im Gaza-Streifen und im Westjordanland stattfinden, ein wohliger Mantel des Schweigens gebreitet. Mit dem Holocaust und dem Antisemitismus-Vorwurf im Nacken, wird man sich davor hüten, die von israelischer Seite begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuklagen. Die Hamas hat angegriffen. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Punkt. Statt uns für einen Friedensprozess einzusetzen, rezitieren wir perspektivenlos das Mantra des Schuld-Kultes: Bedingungslos zu Israel. Bruno Kreisky würde dazu sagen: Lernen Sie Geschichte, Herr Redakteur!
Die Geschichte der Staatsgründung Israels
In diesem Sinne ein kurzer historischer Exkurs: Dass es aufgrund des Antisemitismus einen eigenen Staat als Schutzmacht für die Juden braucht, ist eine Idee des Zionismus, einer politischen Strömung kolonialistischer Prägung, die der österreichische Journalist Theodor Herzl 1896 ersonnen hat. Wenige Jahre später begannen jüdisch-europäische Einwanderer, beseelt von der Idee des Zionismus, sukzessive Land in Palästina aufzukaufen. Die arabische Bevölkerung, die damals sowohl aus Muslimen als auch aus Christen und Juden bestand, wehrte sich von Beginn an gegen die zionischte Besiedelung und die Entstehung eines jüdischen Staates in ihrem Land. Die Gründung des Staates Israel 1948 war keine direkte Folge des Holocaust. Das gab sogar Staatsgründer David Ben Gurion zu Protokoll: „Die Rettung von Juden aus dem nationalsozialistischen Europa, davon hatte ich wenig Kenntnis. Meine Tätigkeit war das Judentum für die Gründung des jüdischen Staates zu gewinnen.“ Nachzulesen ist dieses Zitat in der spannenden geschichtlichen Aufarbeitung „Es war einmal ein Palästina“ des jüdisch-israelischen Journalisten und Historikers Tom Segev.
Welche Rolle der Holocaust für die Gründung des Staates Israel 1948 spielte, beschreibt Segev folgendermaßen: „Die häufige Behauptung, die Staatsgründung sei eine Folge des Holocaust gewesen, entbehrt jeder Grundlage, auch wenn natürlich der Schock, das Entsetzen und die Schuldgefühle, die viele empfanden, ein tiefes Mitgefühl für die Juden im Allgemeinen und die zionistische Bewegung im Besonderen erzeugten. Dieses Mitgefühl kam den Zionisten bei ihren diplomatischen Bemühungen und ihrer Propaganda zugute. Es beeinflusste ihre Strategie dahingehend, dass sie sich auf die jüdischen Überlebenden konzentrierten und von den anderen Nationen forderten, sie nach Palästina zu schicken.“ Was bei der geschichtlichen Analyse auch nicht außer Acht gelassen werden darf, ist die Rolle der Briten, unter deren Mandat Palästina nach dem ersten Weltkrieg stand. Sie unterstützten die zionistische Bewegung aus einem antisemitischen Motiv heraus, wie Segev schreibt: „Durch die Parteinahme für die zionistische Bewegung glaubten die Briten, die Unterstützung eines starken und einflussreichen Verbündeten zu gewinnen. Dahinter steckte die Vorstellung, dass die Juden den Lauf der Geschichte lenkten – eine Vorstellung in der sich auf einzigartige Weise klassische antisemitische Vorurteile mit romantischer Verehrung des Heiligen Landes und seines Volkes vermischten.“ Das jüdische Volk sei allerdings ohnmächtig gewesen und hätte nichts außer diesem Mythos über ihre geheime Macht aufzubieten gehabt. „Die Briten taten so, als wäre die Errichtung einer nationalen Heimstätte für die Juden durchführbar, ohne den Arabern zu schaden, und manche mögen dies tatsächlich geglaubt haben. Aber natürlich war es unmöglich,“ beschreibt Segev die Situation damals.
Der Holocaust und die finanzstarke Lobbyarbeit der Jewish Agency haben dann den gerade gegründeten Vereinten Nationen den finalen Ruck für ihre Zustimmung zum eigenen Staat der Juden gegeben. Man wollte die Juden für den Holocaust entschädigen. Dabei wurden die Anliegen der in Palästina ansäßigen Bevölkerung von der internationalen Gemeinschaft ignoriert. Dieses Ignorieren setzt sich bis heute fort.
Die israelische Anthropologin Norma Musih, mit der Die Krähe im Frühjahr dieses Jahres ein langes Interview führte, kritisiert die Vermengung von Holocaust und Staatsgründung, die auch in Israel betrieben wird. In Israel ist der Gedenktag für die Opfer des Holocaust ein Nationalfeiertag. „Es ist die Frage, ob das ein Nationalfeiertag ist oder ein Tag, an dem es auch um Menschen gehen sollte, die getötet wurden, nicht weil sie Juden oder Zionisten waren, sondern einfach, weil sie anders waren. Der Ansatz den Holocaust für die Zwecke des Zionismus einzuspannen, finde ich sehr problematisch,“ sagt Musih. „Ich würde sagen, der Holocaust ist zuallererst etwas, das Menschen erlitten haben.
Es ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir müssten uns fragen, was wir, nicht nur als Juden, sondern als Menschen daraus lernen können. Wir könnten darüber nachdenken, was wir daraus über Solidarität lernen können,“ führt sie weiter aus.
Das sagt auch die deutsche Journalistin und Autorin Charlotte Wiedemann, die mit ihrem 2022 erschienen Buch „Den Schmerz der Anderen begreifen – Holocaust und Weltgedächtnis“ ein Tabu gebrochen hat. Die ursprünglich geplante Präsentation ihres Buches in der Diplomatischen Akademie in Wien Anfang März dieses Jahres wurde von den Veranstaltern wieder abgesagt. Die Begründung: Ihr Buch würde antisemitische Passagen enthalten. Wiedemann beschreibt in ihrem Werk die massenhafte Ermordung von Menschen in den Kolonien Europas und vergleicht diese Taten mit dem Holocaust, ohne jedoch in diesem Vergleich die spezifische Geschichte und die Machtkonstellationen dahinter zum Verschwinden zu bringen. Sie analysiert jedes Verbrechen spezifisch und die Mechanismen dahinter werden von ihr aufgearbeitet, ob es jetzt die Shoah ist oder ein anderer Massenmord. Sie schreibt: „Empathie braucht Nahrung, Anregung. Nur bleibt alle Nahrung wirkungslos, wenn es eine kognitive und emotionale Sperre gibt, eine generelle Unwilligkeit, in den Opfern ein gemeinsames Menschsein zu erkennen. Wenn ich nationalsozialistische und koloniale Verbrechen vergleiche, dann möchte ich es aus genau diesem Grunde tun: damit wir unsere Sinne und unser Urteilsvermögen schärfen und unsere Empathiefähigkeit erweitern.“ Wiedemanns Worte sind ein Stoßlüften für unseren schuldgetränkten, verknöcherten Diskurs.
Wiedemann fordert, auch die von Tod und Leid geprägten Geschichten und Biografien der Palästinenser anzuerkennen. „In der offiziellen Erinnerungskultur gibt es für diese Biografien keinen Ort, solange Deutschland für die israelische Staatsgründung ein Passepartout benutzt, in dem nur die Shoah Platz hat. Die Vertreibung der Palästinenser ist ein historischer Kollateralschaden, außerhalb unserer Zuständigkeit, jenseits unseres Mitgefühls. Logisch ist das nicht: Gerade wenn der Holocaust als die alles andere überschattende Ursache der Staatsgründung betrachtet wird, wäre die Nakba (die gewaltsame Vertreibung und Ermordung von Palästinensern durch Israelis 1947/48, Anm. der Redaktion) auch ein Teil unserer Geschichte, Teil einer gemeinsamen Geschichte.“
Den Holocaust einfach vergessen?
Noch weiter ging der österreichische Professor für Philosophie Rudolf Burger. Im Jahr 2001 veröffentlichte er in der Tageszeitung „Der Standard“ einen Artikel mit dem Titel „Die Irrtümer der Gedenkpolitik“. Darin plädierte er für eine Amnestie, ein kollektives Vergessen in Bezug auf den Holocaust. „Tatsächlich hat die dauerhafte Memorierung von Großverbrechen seit urvordenklichen Zeiten Folgeverbrechen nicht verhindert, sondern diese im Gegenteil oft genug hervorgerufen und legitimiert; Dass die Erinnerung an das Böse vor dessen Wiederholung schützt, ist also eine höchst fragwürdige These, auf historische Erfahrung stützen kann sie sich nicht“, schreibt Burger. Der Philiosphieprofessor argumentiert mit Beispielen aus der Geschichte. Das Wort „Amnestie“ stamme aus dem Griechischen und heiße „Nichterinnern“. „Es taucht als normativer Begriff in der hellenistischen Kultur des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts auf und meinte nicht einen individuellen Straferlass, sondern eine kollektive Verpflichtung, sich an zugefügtes Leid nicht mehr zu erinnern. So sollte der Hass besänftigt und der Frieden gesichert werden.“ Selbstredend, dass der Sturm der Entrüstung über Burgers Text groß war, aber er blieb bei seiner Haltung und setzte sogar noch eins drauf. In einem Interview mit der Wiener Zeitung, die ihn zu den Vorwürfen gegen ihn Stellung beziehen ließ, sagte er: „Der Holocaust ist zu einem Atout in jeder politischen Auseinandersetzung geworden. Ich halte das für eine schamlose moralische Sekundärausbeutung der Opfer.“
Norma Musih ist mit Burger insofern einer Meinung, als Erinnerung keine Garantie dafür ist, dass Menschen keine Grausamkeiten mehr verüben. Seinem Vorschlag, den Holocaust kollektiv zu vergessen, steht sie jedoch kritisch gegenüber: „Ich denke, die Option zu vergessen ist sehr problematisch. Wenn man vergisst, kann man die Geschichte neu aufbauen oder Geschichten löschen. Ich denke, das ist sehr, sehr gefährlich. Mit der Vergangenheit muss man in ständigem Dialog bleiben. Die Vergangenheit ist wirklich wichtig, wir müssen damit arbeiten und sie nicht löschen.“ Auch würde das Vergessen in Bezug auf den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern nicht helfen, meint sie. „Ich finde nicht, dass man einfach sagen kann, lasst es uns vergessen und fangen wir von Neuem an. Unsere Privilegien basieren auf der Enteignung der Palästinenser. Wir sind nicht in einer Symmetrie und der Konflikt ist nicht vorbei, wir sind mitten im Konflikt. Es ist nicht wie bei anderen Konflikten, wo alles vorbei ist und der Prozess der Versöhnung beginnt. Der Konflikt ist nicht vorbei.“
Der Schuld-Kult trainiert uns das kritische Denken ab. Unser Denken wird alleine in einer Richtung gelenkt: Wir sind schuldig und niemand kann uns davon befreien. Das ist angenehm. Wenn wir uns in den Ritualen des Schuld-Kults ergehen, müssen wir uns nicht den eigenen Dämonen stellen. Durch diesen modernen Ablasshandel sind wir mit unserem Selbsthass beschäftigt. Wer hat dann noch emotional und kognitiv die Kapazität, sich wirklich mit den menschlichen Mechanismen hinter der nationalsozialistischen Mordmaschinerie auseinanderzusetzen? Unsere Lehren daraus zu ziehen und Theorien zu entwickeln, das sollte unsere primäre Beschäftigung mit diesem Thema sein und nicht die zigste Dokumentation über das Liebesleben der Schäferhunde von Adolf Hitler. Das ist Abstumpfung und hat nichts mit kritischer Aufarbeitung zu tun. Das ist, was Burger meinte, als er schrieb: „Das mumifizierende Gedenken verzaubert die Nazizeit zum Mythos.“ Über einen Mythos lässt es sich großartig schwelgen, analysieren aber nicht. Warum wird die großartige Hannah Arendt und ihre „Banalität des Bösen“, daneben „Mein Kampf“ und Gustave le Bons „Psychologie der Massen“ nicht zur Pflichtlektüre an Schulen? Wie konnten Menschen zu Nazis werden? Das ist die alles entscheidende Frage, die immer gestellt, aber nie konsequent und in aller Tiefe durchdacht wird. Dazu muss man auch „Mein Kampf“ gelesen haben. Darin findet sich das Gedankengut, das die Grundsteinlegung war für alles, was danach passierte. Wie sollen wir sonst verstehen? Wirklich und ehrlich verstehen? „Das ist ja wie in der Nazidiktatur.“ Dieser Ausdruck der Empörung ist verpönt, weil er in den Augen mancher verharmlost. Aber das Verpönen verhindert Diskussion und Differenzierung. Wir werden der Fähigkeit des Lernens aus der Geschichte beraubt, wenn wir dieses Beispiel nicht heranziehen dürfen. Ich plädiere für ein Ruhenlassen der Rituale des Schuld-Kults und für eine wahrhaftige Öffnung für den kritischen Diskurs. Dann können wir endlich beginnen, die viel zitierten Lehren zu ziehen und danach zu handeln. Begreifen wir den Holocaust und alles, was mit der Nazidiktatur in Verbindung stand, wie es Charlotte Wiedemann und Norma Musih raten, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und nicht allein gegen Juden. Die Demonstrationsverbote für pro-palästinensische Gruppierungen, das Canceln von öffentlichen Auftritten von Israel-Kritikern, die pro-israelische Berichterstattung in den Medien und die pauschale Diffamierung von kritischen Geistern wie Roland Burger oder eben Charlotte Wiedemann sollte bei uns alle Alarmglocken schrillen lassen. Aber der Schuld-Kult lässt sie alle verstummen.
Der Westen hat eine moralische Verpflichtung, ja – die Opfer und das Leid anzuerkennen – von Juden, aber auch von Palästinensern. Ihre Geschichte ist, wie Charlotte Wiedemann richtig sagt, „Teil unserer Geschichte“. Das anzuerkennen, darum geht es heute und das ist der erste Schritt zur Lösung des Konflikts. Nur so werden wir dem Andenken an die Opfer des Holocaust gerecht.
Quellennachweise:
Kronen Zeitung: https://bit.ly/3GaMC6B, Artikel über Fridays For Future-Posting
Deutsche Bundeszentrale für politische Bildung: https://www.bpb.de/themen/antisemitismus/dossier-antisemitismus/37945/was-heisst-antisemitismus/
Die Irrtümer der Gedenkpolitik: https://www.derstandard.at/story/614981/die-irrtuemer-der-gedenkpolitik
Paul Schreyer
„Ich halte es für naiv zu sagen, wir haben eine Demokratie“
Paul Schreyer hat als engagierter Investigativ-Journalist nicht nur die Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts freigeklagt, sondern auch in seinem Buch „Die Angst der Eliten“ aus dem Jahr 2018 den Zustand unserer Demokratien seziert.
Achtung Verschwörungstheorie!
Von Liza Ulitzka
Er sei ein Opfer der Medienhetze, der Polarisierung, dem Hass auf alles, was nicht dem Mainstream entspricht, urteilt das konservative Spektrum. Selbst das linke Spektrum hat wohl ein wenig schlechtes Gewissen bekommen und kann sich der Magie dieses perfekten Storytellings nicht entziehen: Trump wird nach dem Leben getrachtet, der Schuss verfehlt ihn knapp, trifft jemand anderen und dann das: Trump bäumt sich aus dem Pulk der Securitys auf, blutverschmiertes Gesicht, erhobene Faust vor der US-Flagge und der Ausruf „Kämpft!“.
Der Fotograf drückt ab und wir haben alle Mythen, Heldensagen und das große Kino der Weltgeschichte in einem Bild vereint, an dem kein Medium der Welt vorbei kommt. Trump ist der Phoenix, dem niemand etwas anhaben kann! Er ist unverwundbar. Natürlich wird Gott ins Spiel dieses sagenhaften Kitsches gebracht und selbst als kritische Beobachterin denke ich kurz: Wer sonst soll dieses prächtige Land regieren können? Der Fall ist klar: Der offenbar demenzkranke Joe Biden kann es nicht.
Es ist ein Wahlsieg ohne Wahl. Willkommen in der Welt der politischen Manipulation mit Bildern. Donald Trump beherrscht dieses Spiel wie kein Politiker sonst auf der Welt. Deshalb wird er diese Wahl gewinnen. Was uns dieses Lehrbeispiel zeigt: Wahlen sind keine Ereignisse, bei denen wir freie Entscheidungen treffen. Die Medien und diejenigen, die damit umzugehen wissen, treffen diese Entscheidungen für uns.
„Wir fordern die Veröffentlichung!“
Von Liza Ulitzka
Was ist das Ziel von eurer Veranstaltung am 7. Mai?
Unser Ziel war, Personen aus den beiden Lagern einzuladen, also Verantwortliche, die für die Maßnahmen waren, als auch Kritiker. Es ist uns aber nicht ganz gelungen, mit einer Ausnahme. Wir hatten Personen aus der Regierung und aus den Kommissionen (Corona-Ampel-Kommission, Gecko-Kommission, Anm.) angefragt. Sie haben uns leider alle abgesagt, oder es gab gar keine Rückmeldung. Wir wollten eine Ausgewogenheit bei den Diskutanten und ein breites Bild schaffen. Das wird bedingt gelingen. Unser Ziel ist es ganz konkret über die RKI-Protokolle zu sprechen, aber auch nach Österreich zu schauen. Wir hatten in Österreich einen ganzen Wald an Gremien. Es gab ab Februar 2020 die Corona-Task-Force, ein paar Monate später die Corona-Ampel-Kommission, ab November 2021 die Gecko-Kommission und ein paar weitere. Sie alle haben die Situation abgeschätzt und auch da gibt es Protokolle. In Österreich ist noch kaum etwas öffentlich, mit einer Ausnahme. Von den Protokollen der Corona-Ampel-Kommission sind etwa fünf Monate öffentlich verfügbar, von November 2020 bis März 2021. Diese Kommission startete ihre Tätigkeit im August 2020. Der ORF-Journalist Martin Thür hat Protokolle der Corona-Ampel-Kommission kürzlich ins Netz gestellt und dazu gesagt, diese seien ohnehin immer öffentlich gewesen. Das ist alles bedingt richtig, denn de facto sind nur diese fünf Monate veröffentlicht. Dies ist insofern nachvollziehbar, da laut offizieller Information die Mitglieder der Kommission zu strengster Geheimhaltung verpflichtet waren.
Habt ihr auch Gerald Gartlehner angefragt? Da gab es vor kurzem eine sehr interessante Diskussion zwischen ihm und dem Virologen Martin Haditsch.
Ja, Herrn Gartlehner haben wir anfragt. Er lehnte jedoch ab mit der Begründung, er wolle sich mit dem Thema nicht weiter beschäftigen. Wir haben auch Gesundheitsminister Rauch sowie Herrn Mückstein, Herrn Anschober und Frau Reich, die ehemalige Vorsitzende der Gecko-Kommission, angefragt. Leider gab es von keinem eine Zusage. Herr Rauch und Herr Anschober gaben an, terminlich verhindert zu sein. Herr Anschober schrieb jedoch er hätte gerne teilgenommen und wir kommen gerne darauf zurück. Von Herrn Mückstein und Frau Reich gab es keinerlei Rückmeldung.
Aber ihr habt es geschafft Franz Leisch, den ehemaligen Geschäftsführer von ELGA für die Diskussion zu gewinnen.
Richtig, und die Zusage von Herrn Leisch freut uns sehr. Er hat mit Ende 2022 die ELGA verlassen. Sein Vertrag war ausgelaufen und er hatte sich nicht mehr beworben, weil klar war, dass er aufgrund seiner kritischen Aussagen nicht mehr bestellt werden würde.. Er ist der einzige in der Diskussionsrunde, der aus dem Geschehen heraus mehr berichten kann. Das wird interessant werden.
Fordert ihr auch die Veröffentlichung der Protokolle aller anderen Gremien?
Wir fordern die Veröffentlichung, weil sie für die Menschen und eine systematische und ehrliche Aufarbeitung der Corona-Jahre sehr relevant ist. Ob man die Protokolle freiklagen kann, das müsste man rechtlich prüfen.
Was wären denn eurer Ansicht nach die wichtigsten Protokolle, die veröffentlicht werden sollten? Die von der Ampel-Kommission oder die von Gecko?
Ich denke von beiden. Mich würden auch die des Nationalen Impfgremiums interessieren. Das gibt es schon seit 2010. In Österreich wurde von der Bundesregierung letztes Jahr eine Aufarbeitungsstudie angekündigt und an der Akademie der Wissenschaften durchgeführt, sie ist jedoch definitiv unvollständig. Der Bericht darüber wurde den Bürgern am Donnerstag vor Weihnachten unangekündigt hingeschmissen. Über Weihnachten wird das natürlich vergessen und das hat man ganz bewusst so gemacht, damit das Thema über die Jahreswende einfach verschwindet. Das ist meiner Meinung nach ein riesen Fehler. Ich sehe nach wie vor sehr wenig Verständigung zwischen den Gruppen in der Gesellschaft. Es gibt nach wie vor einen riesen Graben, der sich immer weiter verfestigt hat. Deswegen ist es so wichtig, dass diese Protokolle veröffentlicht werden. Aus den verfügbaren RKI-Protokolle sehen wir schon jetzt eine Reihe von Punkten, wo klar ist, dass die Maßnahmenkritiker mit ihrer Einschätzung richtig lagen. Es ist so wichtig, dass das einmal thematisiert wird. Freigeklagt konnten nur rund 15 Monate werden. Das ist ja nur die Zeit, in der Jens Spahn Gesundheitsminister war. Alles was die Lauterbach-Periode betrifft ist für die Öffentlichkeit nicht verfügbar. Ich erwarte mir aus den Diskussionen des RKI-Krisenstabs über die Maßnahmen oder die modifizierte RNA-Impfung noch viel mehr Brisantes.
Habt ihr euch die RKI-Files genauer angesehen und habt ihr noch neue Informationen herausgefiltert?
Ja, da gibt es zwei Informationen, die mir zusätzlich zu dem was bereits bekannt ist, sehr wichtig erscheinen. Ich komme selbst aus den Naturwissenschaften, habe viele Jahre in einem Pharmaunternehmen im Bereich Biotechnologie gearbeitet. Dem entsprechend habe ich genau auf wissenschaftliche Aspekte geschaut. Ich habe die RKI-Files konkret auf den Begriff RNA-Vakzine durchsucht, um zu sehen, was das RKI hierzu sagt. Es gibt wenig, aber ich habe zwei sehr relevante Stellen gefunden. Da schreiben sie an einer Stelle: ‚Es gibt jedoch bislang keine Erfahrung mit RNA- und DNA-Vakzinen, im Zulassungsprozess unter Umständen relevant.’ Ich finde das ist ein ganz entscheidender Satz. Er stammt aus einem Protokoll aus April 2020. Es wurde ja immer wieder gesagt, es gäbe bereits umfassend Erfahrung mit der Anwendung am Menschen. Die Wissenschaft wisse es und wir sollen das gefälligst akzeptieren. Das wurde auch in der Bewerbung immer wieder betont. ‚Der Impfstoff ist wirksam und sicher’ hieß es immer. Von wegen „wirksam und sicher“. RNA-Vazine sind nicht ausreichend untersucht. Die klinischen Studien von Biontech/Pfizer sind keine gute klinische Praxis.
Warum nicht?
Weil teilweise auch schlampig gearbeitet wurde, dies wurde auch öffentlich bekannt. Auch der primäre Endpunkt ist mehr als erstaunlich. Im klinischen Studienprotokoll ist definiert, dass eine Corona-Erkrankung erst sieben Tage nach der zweiten Impfung zu dokumentieren ist. Zwischen erster und zweiter Impfung waren etwa drei, vier Wochen. Das heißt man hat fünf Wochen lang nicht erfasst, wenn jemand in diesem Zeitraum eine Infektion hatte. Wenn ein Studienteilnehmer geimpft wurde und die Person drei Tage später Corona bekam, wurde das nicht gezählt. Man weiß zum Beispiel auch nichts darüber, wie sich der Wirkstoff im Körper verteilt. Wir erinnern uns alle, wie Minister Mückstein gesagt hatte, der sogenannte Impfstoff bleibe im Muskel an der Einspritzstelle. Aus wissenschaftlichen Studien wissen wir jedoch in der Zwischenzeit, dass sich die Spike-Proteine verteilen und Monate nach der sogenannten Impfung in verschiedensten Organe gefunden wurden. Weiters wissen wir zum Beispiel auch nicht, wie schnell sich der Wirkstoff abbaut oder wie der Körper auf die durch mehrere internationale Arbeitsgruppen nachgewiesenen DNA-Rückstände aus dem Produktionsprozess reagiert. Diese DNA-Rückstände können durch die formulierten Lipid-Nanopartikel in den Zellkern gelangen, gleich wie die modifizierte RNA. Da sind viele Fragen einfach offen. Gleichzeitig hat man ständig behauptet, dass diese Stoffe jahrzehntelang in der Forschung sind und breit angewendet wurden. Das stimmt einfach nicht. Man hatte RNA punktuell in der Krebs-Therapie angewendet, aber nicht flächendeckend und nie als Impfstoff für eine respiratorische Infektionskrankheit. Das RKI sagt auch, dass Geimpfte aufgrund des Impfzertifikats keine Privilegien haben sollten. Aber genau das ist in Österreich und in Deutschland passiert, wir erinnern uns an den langen Lockdown für ungeimpfte Menschen.
Was war der zweite Punkt, der aufgefallen ist?
Dieser Punkt betrifft den PCR-Test. PCR war ja das Mittel der Wahl, wenn der Test positiv war, dann galt man als krank, ob man Symptome hatte oder nicht. Wir hatten beispielsweise in unseren Presseaussendungen mit dem Titel „Die Große Aufarbeitung“ wiederholt die Aussagekraft hoher CT-Werte und eine fehlende Kalibrierung auf infektiöses Potenzial mittels Viruskultur kritisiert. Das RKI dokumentierte hierzu in einer Sitzung im Mai 2020, dass etwa 170 von ihnen untersuchte Proben bei einem CT-Wert größer 32 in der Zellkultur nicht wuchsen. Das RKI schreibt wörtlich „Bei CT> 30 wachsen 98% nicht, bei CT>29 96% nicht. Das heißt übersetzt, dass jemand der einen CT-Wert von ca. 30 hatte, überhaupt nicht infektiös war. Trotzdem hat man diese Menschen in Quarantäne geschickt. Unserer Ansicht nach sind auch in Österreich aufgrund des festgelegten CT-Grenzwertes tausende Menschen ungerechtfertigt in Quarantäne gewesen.
Gab es bei den Protokollen der österreichischen Ampel-Kommission irgendetwas, das interessant war?
Dieses Gremium hat hauptsächlich vorbereitend gearbeitet und sich die Zahlen und Daten für Österreich angesehen und auch das Ausland beobachtet. Sie haben dann Empfehlungen an die Regierung weitergegeben. Diese hatte selbstverständlich einen Entscheidungsspielraum betreffend Festlegung der Corona-Ampel von grün bis rot. Ein Punkt war recht interessant und inwieweit man Maßnahmen aufgrund von Fallzahlen oder anderen erhobenen Daten verschärfen oder lockern könne. An einer wird konkret über die Lage in Tschechien und der Slowakei berichtet. Da sagen sie, dass trotz wörtlich „drakonischer Maßnahmen“ bzw. „rigideste Maßnahmen“ in diesen beiden Ländern, die Fallzahlen nicht gesenkt werden konnten. Trotz allem wurden die Maßnahmen in Österreich nicht gelockert, obwohl sie bei den Nachbarländern gesehen haben, dass es gar nichts bringt.
Was wäre darüber hinaus noch interessant zu wissen, wenn alle Protokolle freigegeben würden?
Diese berühmte Frage zum Ursprung des Covid-19 Virus. Was sagen die Protokolle hierzu? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich darüber nicht unterhalten hat. Das ist doch eine zentrale Frage und darüber wurde auch wissenschaftlich publiziert. Der Virus ist ganz klar synthetisch hergestellt. Das ist ein Virus aus dem Labor.
Wer hat das publiziert?
Zum Beispiel eine Arbeitsgruppe an der Universität Würzburg, Dr. Valentin Bruttel hat eine sehr schöne Arbeit gemacht. Er ist Molekularbiologe und er hat mit seiner Arbeitsgruppe das ganze Virus-Konstrukt fachlich analysiert. Er berichtet, dass sogenannte stille Mutationen am Genom bei Viren nur in geringer Zahl vorkommen und zufällig verteilt sind. Beim Covid-19 Virus fanden sie jedoch zwölf stille Mutationen an ganz bestimmten Schnittstellen. Die Natur macht aber so etwas nicht. Die Natur würde laut Dr. Bruttel im Durchschnitt eineinhalb solche Mutationen einbauen. Das weiß man aufgrund verwandter Viren. Und damit leitet er mit einer Sicherheit von 1 zu 1 Million ab, dass dieses Virus synthetisch hergestellt wurde.
Gibt es denn interessante Aspekte im Corona-Aufarbeitungsbericht der Akademie der Wissenschaften?
Relevant fand ich den zweiten Teil der Studie, in dem rund 300 Bürger befragt wurden, was sie aus der Corona-Krise ableiten. Die wichtigsten drei Punkte waren, die Unabhängigkeit der Wissenschaft muss gewährt sein, was nicht der Fall war, meiner Meinung nach. Der zweite Punkt war die Unabhängigkeit der Medien, was ebenfalls nicht gegeben war. In Deutschland gab es inzwischen den einen oder anderen kritischen Zeitungsbericht, aber in Österreich null. Der dritte Punkt war, die Bürger wollen, dass unterschiedliche Verhaltensweise in einer Krise erlaubt sein müssen. Ich finde das trifft es auf den Punkt. Diese Anwürfe an Menschen, die anders über die Krise gedacht haben, waren kaum zu ertragen. Bezüglich Medien stand auch etwas Interessantes drinnen. Ab 2022 gaben 40 Prozent der Bevölkerung an, Corona-Nachrichten von den Mainstream-Medien bewusst sehr häufig zu meiden.
Was erwartet ihr trotzdem für die Konferenz, auch wenn euer Ursprungsplan für einen breiten Dialog und Brückenschlag nicht aufgegangen ist?
Ich glaube es ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Das Thema Aufarbeitung wird weitergehen und ich denke die RKI-Files sind ein wichtiges Puzzlestück und dieses Puzzle wird sich immer weiter füllen. Es arbeiten so viele verschiedene Initiativen, Arbeitsgruppen und Länder an den verschiedensten Themen, ob es jetzt der Wirkstoff, der Ursprung des Virus oder auch was die Grundrechtseinschränkungen anbelangt. Meine Hoffnung ist, dass wir es als Gesellschaft schaffen, die Lehren zu ziehen, die es braucht, um der nächsten Krise besser zu begegnen.
Nähere Infos zur Konferenz gibt es unter https://www.corona-aufarbeitung.at/
Es sind noch einige wenige Tickets erhältlich.
ÖJC droht mit rechtlichen Schritten
Von Liza Ulitzka
„Alles was ich geschrieben habe, entspricht der Wahrheit und das kann ich auch belegen“, sagt Liza Ulitzka, Chefredakteurin von Die Krähe. Der Aufforderung den Artikel zu entfernen, werde sie deswegen nicht nachkommen. Denn es sei immer noch erlaubt, die Wahrheit zu schreiben, wie ihr eine unterstützende Anwältin bestätigte. Einer möglichen Klage durch den ÖJC sieht Ulitzka gelassen entgegen. Die völlig überzogene Reaktion des ÖJC sei viel mehr entlarvend für einen Verein, der von sich behauptet, sich für die Pressefreiheit einzusetzen.
Im Folgenden einige Zitate aus dem Anwaltsschreiben, kommentiert von Liza Ulitzka:
Dieser Artikel enthält Angaben, welche sowohl mit den Statuten meiner Mandantschaft, als aber auch nicht dem österreichischen Vereinsgesetz, dem Österreichischen Journalistenkodex, aber auch nicht mit den Anforderungen an die journalistische Tätigkeit im Einklang stehen.
Ihr Artikel lässt auch wesentliche Tatsachen unerwähnt, deren Anführung zu einer anderen Betrachtung des Sachverhalts durch die Leser/ Leserinnen, als von Ihnen einseitig dargestellt, führen würde.
Auf welche Tatsachen die Anwältin sich hier bezieht, erschließt sich mir nicht. Sie werden in dem Schreiben nicht aufgeführt.
Ich habe Sie daher jedenfalls aufzufordern die Veröffentlichung des Artikels „ Chefredakteurin Die Krähe aus Journalistenverein geworfen“ unverzüglich auf der Homepage www.diekraehe.at zu entfernen. Zudem haben Sie es zu unterlassen derartige sinngleiche Äußerungen anderweitig öffentlich zu tätigen. Weiters haben Sie es zu unterlassen meine Mandantschaft bzw. deren Vorstandsmitglieder öffentlich der Lüge und/oder der Erpressung zu zeihen.
In meinem Artikel habe ich weder von “Lüge” noch von “Erpressung” gesprochen.
Sollte dieser Aufforderung von Ihnen nicht entsprochen werden (…), so wird meine Mandantin unverzüglich den Rechtsweg beschreiten.
Chefredakteurin von Die Krähe aus Journalistenverein geworfen
Liza Ulitzka, Chefredakteurin von Die Krähe, wird vom Österreichischen Journalistenclub ausgeschlossen, weil sie sich dort für Julian Assange eingesetzt hat. Sie hat Hausverbot und muss den Journalistenausweis retournieren oder seine Vernichtung beweisen.
Von Liza Ulitzka
„Wollen Sie nicht als Vorstandsmitglied bei uns fungieren?“, fragte der Präsident des Österreichischen Journalistenclubs (ÖJC) mich letztes Jahr im September. „Nicht nur weil Sie eine Frau sind, das ist wirklich nicht der alleinige Grund, sondern weil Sie sich so für den kritischen Journalismus einsetzen.“ Das Angebot nahm ich gerne an, weil ich darin auch eine Chance sah, unabhängigem Journalismus öffentlich mehr Gewicht verleihen zu können und ein Forum für kritische Themen zu bekommen.
Die Zusammenarbeit lief, abgesehen von ein paar Friktionen, recht gut, bis es vergangene Woche zum Eklat rund um eine Aktion für die Freilassung des Wikileaks-Gründers Julian Assange kam. Der Präsident des ÖJC wollte zwei Tage bevor der ÖJC gemeinsam mit der Gruppe „Candles for Assange“ offene Briefe an die Botschaften von Australien, USA und Großbritannien übergeben wollte, die ganze Aktion abblasen. Der Grund: Der ÖJC dürfe „als unabhängiger Verein nicht politisieren“ und auch weil ihm das der Ethikkodex des ORF verbieten würde. Ich habe dagegen protestiert und dafür plädiert, die Aktion durchzuführen. Zweimal habe ich um ein klärendes Gespräch gebeten, was abgelehnt bzw. nicht beantwortet wurde.
Stattdessen trat der Präsident von seiner Funktion zurück. Am nächsten Tag bat ich die Vorstandsmitglieder darum, darüber abzustimmen, ob wir die Assange-Aktion durchführen sollen oder nicht. Eine Mehrheit entschied dafür und ich durfte am 16. Februar als Vertreterin des ÖJC gemeinsam mit Marie-Odile Dorer von „Candles for Assange“ die offenen Briefe an die britische und die australische Botschaft übergeben. Auf einem Foto waren Marie-Odile und ich zu sehen, wie wir einen offenen Brief, abgestempelt von der australischen Botschaft, in Händen halten. Das Foto wurde auf der Website des ÖJC veröffentlicht, inzwischen aber entfernt. Jetzt sind nur mehr die Gruppenfotos von mir und den Aktivisten von „Candles for Assange“ zu sehen.
Am vergangenen Samstag wurde mir, wegen eines Vorschlags in der internen Chatgruppe des Vorstands und wegen der von mir veranlassten Abstimmung zur Assange-Aktion, „vereinsschädigendes Verhalten“ zur Last gelegt und ein Aktenvermerk über mein „Fehlverhalten“ erstellt. Mein Verhalten sollte bei der anstehenden Generalversammlung am 15. März besprochen werden und der Rücktritt aus dem Vorstand wurde mir nahegelegt.
Ich verweigerte den Rücktritt, erklärte mich aber sehr gerne dazu bereit, alle Angelegenheiten in der Generalversammlung offen zu besprechen. Daraufhin veranlasste der noch-Präsident eine Abstimmung unter den Vorstandsmitgliedern, die zu meinem Ausschluss aus dem Verein führte.
Ich mache all das öffentlich, nicht weil ich offene Rechnungen begleichen will, sondern um aufzuzeigen, wie es um die Medien- und Pressefreiheit in Österreich steht. Es ist erschreckend zu sehen, dass eine kleine Aktion für die Freilassung von Julian Assange so viel Gegenwind erzeugt und es wirft zahlreiche Fragen über die Unabhängigkeit des Österreichischen Journalistenclubs auf. Nach außen hin vermeldet der ÖJC ich hätte mich „aus persönlichen Gründen“ zurückgezogen, was nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe ein internes Schiedsgerichtsverfahren gefordert.
In diesem Sinne:
Freiheit für Julian Assange! Freiheit für alle politisch verfolgten Journalisten weltweit! Journalismus kann nur unabhängig sein, wenn er allein von den Lesern finanziert wird.
Konto von Die Krähe gekündigt
Kritischer Journalismus unerwünscht?
Kafka lässt grüßen. Am 11.1. wird mir ein Einschreiben der Bank99 zugestellt, wo Die Krähe im November 2022 ihr Konto für die Bezahlung der Monatszeitung eröffnet hat. „Hiermit kündigen wir Ihr am 10.11.2022 eröffnetes Konto. Gemäß unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen passiert das unter Einhaltung einer zweimonatigen Kündigungsfrist.“ Gründe für die Kündigung werden keine genannt. Wie kann das sein?
Von Liza Ulitzka
Ich kontaktiere per e-Mail meinen Bankberater und bekomme keine Antwort. Dann rufe ich bei der Hotline an. Die Dame, die antwortet, bittet darum zu warten. Nach ein paar Minuten meldet sie sich zurück und sagt: „Genaue Informationen habe ich jetzt leider nicht. Aber benutzen Sie das Konto für Ihren Verein?“ Sie hat keine genauen Informationen, weiß aber dass das Konto für einen Verein genutzt wird? Interessant. Als ich das bejahe und frage, was das Problem sei, meinte sie nur, dass das verboten sei. Ich beteuere, dass der Bankberater bei der Eröffnung des Kontos davon wusste und nicht gesagt hat, dass das ein Problem sein könnte. Er meinte damals lediglich, dass es vielleicht ein Problem sein könnte, dass das kein Geschäftskonto sei. Da die Beträge, die auf das Konto fließen, zu Beginn wahrscheinlich nicht nennenswert seien, könne man das aber durchaus so belassen. Man könnte das später immer noch anpassen. Die Dame bei der Hotline meint, sie würde nun ein e-Mail an den Bankberater schreiben und er müsse sich darum kümmern. Ich frage noch, warum mir in dem Schreiben kein Grund für die Kündigung genannt wird. Sie argumentiert mit Datenschutz. Datenschutz? Bei einem Einschreiben in dem es um mein eigenes Konto geht? Die Dame wimmelt mich ab und legt auf.
Dann passiert ein paar Tage lang nichts. Dann probiere ich es noch einmal bei der Hotline. „Genaue Gründe weiß ich leider auch nicht, hier ist nur vermerkt, dass es eine geschäftspolitischer Entscheidung war“, erklärt der Herr freundlich. Schließlich bekomme ich den Bankberater doch noch ans Telefon. Auch er beginnt mit der Leier des Vereins und ich konfrontiere ihn damit, dass er damals meinte, dass das kein Problem sei. Er kommt ins Stammeln. Dann fragt er, ob ich keine andere Information wegen der Kündigung bekommen habe. Ich verneine. „Das ist sehr eigenartig“, meinte er daraufhin und verspricht sich darum zu kümmern. „Das kann aber etwas dauern“, so der Berater. Bis jetzt habe ich keine Antwort erhalten. Dass die Bank offenbar kein Interesse daran hat, eine Lösung für das Problem zu finden, ist eigenartig. Man könnte das Konto zum Beispiel in ein Geschäftskonto oder Vereinskonto umwandeln. Normalerweise würde man doch versuchen einen guten Kunden zu halten. Die Krähe muss sich nun nach einem neuen Konto umsehen, was mit einem enormen bürokratischen Aufwand verbunden ist. Unsere Arbeit wird trotzdem weitergehen.
Ergänzungen und Erweiterungen zur Printausgabe von Die Krähe
Bei unserer journalistischen Arbeit sind wir sehr gründlich. Wir führen ausführliche Interviews, machen lange Recherchen. Dabei fällt viel Material an. Für die Artikel selbst können wir nur einen Bruchteil davon verwenden. Alle Interessierten können hier weiter in die Tiefe gehen.
„Langfassung des Interviews mit Norma Musih,
aus den Recherchen zu Ausgabe 4 und 5.
„Wir müssen den Zionismus verlernen“
Eine Diskussion um den Konflikt zwischen Juden und Palästinensern und die über den Zionismus ist heikel. Wegen der Nazivergangenheit von Deutschland und Österreich kommt jede Kritik am Agieren des Staates Israel einem Tabubruch gleich. In Israel selbst werden kritische Ansätze hingegen offen diskutiert. Norma Musih ist Kultur- und Sozialanthropologin und arbeitet als Doktorandin an der Ben-Gurion-Universität des Negev. Im Interview mit Die Krähe erzählt sie von ihrer Kritik am Holocaust-Gedenken in Israel und wie sie den Konflikt zwischen Juden und Palästinensern lösen würde.
Ein Interview von April 2023 mit der israelischen Anthropologin
Norma Musih
Die Krähe: Die politische Situation in Israel ist derzeit sehr herausfordernd. Wie erleben Sie die Politik dieser extrem rechten Regierung?
Norma Musih: Auf der einen Seite ist es ein Alptraum. Ein Teil meiner Arbeit ist auch Politikwissenschaft und ich studiere die Werke von Hannah Arendt über Totalitarismus. Im Moment gibt es dafür lebende Beispiele. Ich selbst wurde 1976 in Buenos Aires geboren, während der Diktatur. Ich habe Kinder und das alles hier macht Angst. Auf der anderen Seite versuche ich positiv zu denken. Die Dinge werden jetzt ganz klar und wir müssen Stellung beziehen. Wir können nicht von Demokratie sprechen, solange es nicht eine Demokratie für alle ist. Das heißt auch für Palästinenser und für palästinensische Flüchtlinge. Wir können nicht über Demokratie allein aus der jüdischen Perspektive sprechen.
Die Krähe: Sie wurden in Buenos Aires geboren. Wie kamen Sie nach Israel?
Das hatte hauptsächlich familiäre Gründe. Ein Teil der Familie war hier und sie wollte zusammen sein. Ich denke es gab auch ein paar versteckte zionistische Motivationen im Hintergrund (lacht).
Die Krähe: Israel feiert seinen 75. Geburtstag dieses Jahr. Die Grundlage für die Erschaffung des Staates Israel war der Zionismus. Glauben Sie, dass der Zionismus die Wurzel für den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist?
Ja, natürlich. Ein Teil meiner Arbeit macht die Erforschung des Zionismus und des Holocaust aus. Natürlich gab es historische Gründe, warum der Staat etabliert wurde. Aber nach dem Holocaust gab es mehr als nur eine Option, wie das zu tun wäre. Sogar innerhalb des Zionismus gab es viele verschiedene Strömungen. Es gab kulturellen Zionismus, es gab eine Gruppe, die „Beit Shalom“ hieß, die über die Möglichkeit eines binationalen Staates nachdachte. Wenn ich auf die Geschichte blicke, versuche ich zu analysieren, welche Wege schlussendlich eingeschlagen wurden. Der Zionismus hat an einem Punkt beschlossen, diesen einen Weg einzuschlagen und das Ergebnis ist das, was wir heute sehen. Aber es hätte mehr Möglichkeiten gegeben.
Die Krähe: Auf welche Art und Weise ist der Holocaust noch Teil der Identität Israels und seiner Bürger?
Er macht einen großen Teil aus. Vom Kindergarten an lernen wir über den Holocaust. Ich sehe es sehr kritisch, wie der Staat über den Holocaust unterrichtet. Einerseits denke ich, es ist sehr wichtig, alles über den Holocaust zu lernen. Es ist etwas, das überall auf der Welt gelehrt werden sollte. Andererseits kritisiere ich sehr, wie der Staat den Holocaust für seine Zwecke benutzt.
Die Krähe: Können Sie dafür ein Beispiel geben?
Sogar die Art und Weise wie der Opfer des Holocaust gedacht wird, der Gedenktag ist eine Woche vor dem Unabhängigkeitstag, diese beiden Tage liegen zeitlich eng beieinander. In Israel werden diese Tage Nationalfeiertage genannt. Es ist die Frage, ob das ein Nationalfeiertag ist oder ein Tag, an dem es auch um Menschen gehen sollte, die getötet wurden, nicht weil sie Juden oder Zionisten waren, sondern einfach weil sie anders waren. Der Ansatz, den Holocaust für die Zwecke des Zionismus einzuspannen, finde ich sehr problematisch.

Die Krähe: Sie meinen, an den Holocaust wird auf die falsche Weise erinnert? Was wäre Ihrer Meinung nach der richtige Weg?
Ich würde sagen, der Holocaust ist zu Beginn etwas, das Menschen erlitten haben. Es ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir müssten uns fragen, was wir, nicht nur als Juden, sondern als Menschen daraus lernen können. Wir könnten darüber nachdenken, was wir daraus über Solidarität lernen können.
Die Krähe: Wenn Sie sagen, es sollte als Verbrechen gegen die Menschlichkeit angesehen werden, meinen Sie, es sollte nicht nur als Verbrechen allein gegen Juden betrachtet werden?
Ja und Nein. Sehr viele Juden wurden getötet, das ist auch Teil meiner Familie und etwas, das mir auf verschiedene Art und Weise sehr nahe geht. Aber auf der anderen Seite waren das auch Menschen. Es waren nicht nur Juden, die im Holocaust umgekommen sind. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist die andere Seite zu verstehen. Wie konnten Menschen zu Nazis werden? Es ist auch sehr wichtig, dass man das verstehen lernt.
Die Krähe: In dem Buch „Es war einmal ein Palästina“ von Tom Segev habe ich gelesen, dass Israels Staatsgründer David Ben Gurion sich nicht besonders mit dem Holocaust beschäftigt hat. Er sagte, sein Hauptziel wäre die Etablierung des Staates Israel. Ausschlaggebend für die Gründung Israels war also nicht der Holocaust, sondern einfach einen jüdischen Staat zu bekommen. Erst später hätten die Zionisten den Holocaust propagandistisch genutzt, um dem „Projekt Israel“ mehr Nachhaltigkeit zu verleihen. Wie sehen Sie das?
Wissen Sie, ich erforsche die Geschichte der Gegenwart. Unsere Gegenwart ist eine sehr zionistische und sie spiegelt die Geschichte wider. Ich weiß, dass Tom Segev und andere die 40er-Jahre erforscht haben und dass sie zu diesen interessanten Schlüssen gekommen sind. Auf der einen Seite gab es dieses zionistische Programm und es ist wichtig, es zu rekonstruieren. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig zu sehen, wer damit nicht einverstanden war. In dieser Zeit gab es den „Bund“, diese Gruppe von kommunistischen Juden, die nicht zionistisch waren und versucht haben, eine Alternative zum Zionismus zu schaffen.
Die Krähe: Wie sah die aus?
Sie wollten eine Integration in einer sozialistischen Gesellschaft. Sie waren sehr aktiv in Arbeiterbewegungen oder kommunistischen Bewegungen und sehr stark. Sogar in Argentinien gab es Communities von orthodoxen Juden, die sich in landwirtschaftlichen Gegenden von Argentinien formierten und ein jüdisches Leben abgekoppelt von Nationalität lebten. Was ich sagen will, ist, dass es verschiedene Formen von jüdischem Leben gab, die losgelöst waren von Nationalismus, sowohl von orthodoxen als auch von säkularen Juden.
Die Krähe: Sie haben einen eigenen Ansatz zur Lösung des Konflikts zwischen Juden und Palästinensern. Sie nennen ihn „Unlearning Zionism“ (Zionismus verlernen). Können Sir mir erklären, wie Sie das meinen?
Das „Verlernen“ ist ein Teil, aber wir müssen auch aktivistisch sein und wir müssen Visionen für die Zukunft entwickeln. Aber das, was wir am schnellsten tun können, ist, das zu verlernen, was wir wissen. Der Zionismus präsentiert sich aber als der einzige Weg, den wir nehmen konnten. Es ist immer dieselbe Geschichte: Es gab einen Krieg (der erste jüdisch-arabische Krieg 1947, Anm.), wir haben gewonnen, sie haben verloren. Sie werden uns das antun, was wir ihnen angetan haben und so weiter. Als erstes müssen wir also diese Geschichte „verlernen“ und fragen, was ist mit den Palästinensern passiert? Wo waren die Palästinenser? Denn sogar wenn wir von Palästina sprechen, verstehen wir nicht vollständig, dass Palästina eigentlich hier ist. Wir leben buchstäblich in palästinensischen Dörfern, palästinensischen Städten, palästinensischen Communities. Als erstes müssen wir die gesamte Landschaft „verlernen“. Dann müssen wir über die Zerstörung dieser Orte lernen, wie das passiert ist. In meiner Forschung und auch in der von anderen Wissenschaftlern, habe ich festgestellt, dass diese palästinensischen Orte nicht während des Krieges zerstört wurden, sondern nach dem Krieg. Es gab auch Zerstörung während des Krieges, aber das waren Gebäude, die wiederaufgebaut hätten werden können. Normalerweise dürfen Flüchtlinge nach einem Krieg wieder in ihre Häuser zurückkehren. Das besagt die Genfer Konvention, die auch Israel unterzeichnet hat. Aber wir müssen über die Konfiszierung von all diesem palästinensischen Eigentum lernen, das jetzt dem israelischen Staat gehört. Das war palästinensisches Eigentum, das gestohlen wurde. Und was ist mit den palästinensischen Flüchtlingen passiert? Wir müssen auch über die Mechanismen lernen, die dieses Wissen gelöscht haben. Denn man musste einiges an Anstrengung unternehmen, um dieses Wissen zu löschen. Wenn es ein Dorf gab, musste man es verstecken, man musste es zerstören, man musste aktiv etwas tun, um es zum Verschwinden zu bringen. Wie ist es dazu gekommen?
Freiheit für Assange
Es war noch nie so dringend für Julian Assanges Freiheit zu kämpfen wie jetzt. Am 20. und am 21. Februar wird der Oberste Gerichtshof in Großbritannien eine Anhörung durchführen. Dabei wird sich entscheiden, ob Julian gegen die Entscheidung, dass er in die USA ausgeliefert werden darf, berufen kann. Wenn das Gericht Julian nicht erlaubt Berufung einzulegen, dann gibt es für ihn in Großbritannien keine Rechtswege mehr. Er könnte innerhalb von 24 Stunden an die USA ausgeliefert werden. Die einzige Möglichkeit, die Julians Team dann noch bleiben würde, wäre der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Dort könnten seine Rechtsvertreter darum ansuchen, die Auslieferung zu blockieren. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass der EGMR dem stattgeben würde.
Auf der ganzen Welt kämpfen die Unterstützer von Julian Assange für seine Freiheit. In den USA haben Kongressabgebordnete aus allen politischen Spektren eine Kongress-Resolution verabschiedet, die die US-Regierung dazu auffordert alle Anklagepunkte gegen Assange fallen zu lassen und den Auslieferungsantrag zurück zu ziehen, da alle journalistischen Aktivitäten durch den ersten Verfassungszusatz geschützt sind.
Den ganzen Dezember über war #Assange ein Trend auf Twitter. Der Dokumentarfilm „The Trust Fall: Julian Assange“ wird seine Premiere in Brisbane und Adelaide haben. Am 18. Jänner wird es eine Demonstration für Julian in London geben. Am 9. März wird es eine wichtige Konferenz in Melbourne geben.
Über Briefe an verschiedene verantwortliche Politiker in Australien wird versucht politischen Druck auszuüben.
Am 22. Jänner plant der Österreichische Journalistenclub eine Podiumsdiskussion zum Ausgang der Anhörung. Die Krähe wird sie mit weiteren Infos zu Aktionen für die Freilassung von Julian Assange weiter auf dem Laufenden halten.