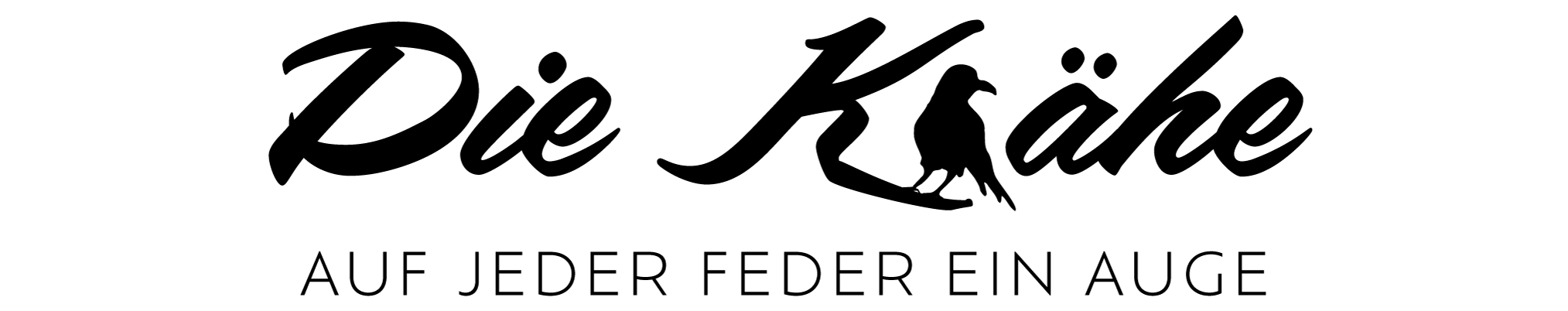Immer mehr Israelis verweigern den Wehrdienst bei den IDF (Israel Defence Forces) © www.BergWolf.Agency
Von Susanne Wolf
"Wir verweigern"
Israel ist stolz auf sein Militär. Dieser Stolz reicht bis tief in die Gesellschaft hinein. Bereits in der Grundschule werden Mädchen und Buben auf den späteren Dienst in der Armee vorbereitet. Doch seit dem Beginn des Genozids in Gaza 2023 blättert der Lack am Nationalsymbol. Immer mehr junge Menschen verweigern ihren Dienst. Und sie bezahlen einen hohen Preis dafür.
Der 19-jährige Israeli Iddo Elam hat vor Jahren einen Entschluss gefasst. Damals stand er in Ostjerusalem und im Westjordanland Seite an Seite mit Palästinensern und mit seinen israelischen Freunden. Sie demonstrierten gegen die israelische Besatzung. Sie wurden verprügelt oder verhaftet. Besonders die Palästinenser hatten unter der Willkür des israelischen Militärs zu leiden. Was er damals, als er keine 16 Jahre alt war, zu sehen bekam, erschütterte ihn. Nicht so sehr das Ausmaß der Repression. Die war und ist bis heute Alltag in den besetzten Gebieten. Was ihn zutiefst erschreckte, war, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis er selbst als Soldat dort stehen würde, mit vorgehaltener Waffe auf diejenigen zielend, deren Rechte er gerade verteidigte. „Daran wollte ich mich nicht beteiligen“, erzählt er in einem Zeitungsbericht. Ein Satz der schnell ausgesprochen ist, in Israel jedoch schwere Konsequenzen nach sich zieht …
Nichts sehen, hören und wissen will die österreichische Regierung von einer Aufarbeitung der Corona-Zeit.
© tinyurl.com/5eucz87r
Von Barbara Gräftner
Einmal Notstand, immer Notstand
Notstandsgesetze hatten in der Vergangenheit oft gravierende Folgen: Der Notstand ging vorüber – das Gesetz blieb. Bei den internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO droht so ein Szenario. Und zwar unter dem Radar der Öffentlichkeit.
Die IGV, die internationalen Gesundheitsvorschriften, sind ein völkerrechtlich verbindlicher Rahmenvertrag. Sie verpflichten also Staaten gegenüber anderen Staaten im Falle grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren. Die Pflichten sind: Meldung der Vorfälle, Informationsaustausch und Kooperation zwischen den Staaten und die Begründung ihres Handelns. Instrument zur Durchsetzung ist vor allem eine Rechtfertigungspflicht und politischer Druck. Die WHO kann keine Gesetze erlassen und hat keine Exekutivgewalt, sie kann nur feststellen und empfehlen.
Mag. Dr. Silvia Behrendt, Spezialistin für internationales Gesundheitsrecht, sagt dazu: „Die WHO selbst hat keine verbindlichen Lockdowns, Impfpflichten oder Grenzschließungen angeordnet – das kann sie nicht, sie kann nur empfehlen. Die Verantwortung für die konkrete Umsetzung der Empfehlungen der WHO in nationales Recht liegt bei der jeweiligen nationalen Gesetzgebung.“
Die Neufassung der IGV von 2024 ist vor allem deshalb sehr genau zu betrachten, weil sie ergänzend zum sogenannten „Internationalen Gesundheitsnotstand“ PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) eine neue Eskalationsstufe einführt: nämlich die „pandemische Notlage“.
Notfallverordnungen sind brandgefährlich, weil sie, einmal vom Parlament beschlossen, unbestimmte staatliche Eingriffsbefugnisse bedeuten, Grundrechte betreffen, die Gewaltenteilung gefährden. Mit Hilfe von Notfallmaßnahmen verschaffen sich Regierungen Rechte, die die Bürger ihnen sonst nie gewähren würden.
Die neue Kategorie „pandemische Notlage“ ist praktisch eine Erweiterung des PHEIC, dessen Umsetzung durch unsere Regierung wir während der Corona-Pandemie am eigenen Leib genießen durften, mit all den vom Verfassungsgerichtshof anerkannten Fällen von Grundrechtsverletzungen. PHEIC und „pandemische Notlage“ sind beides Feststellungen einer erheblichen gesundheitsgefährdenden Situation durch die WHO.
Wohlgemerkt: Die Grundrechtsverletzungen während Corona …
BRANDNEUE AUSGABE NR. 17
BESTELLEN
Unter anderem in der aktuellen Ausgabe (Nr. 17)
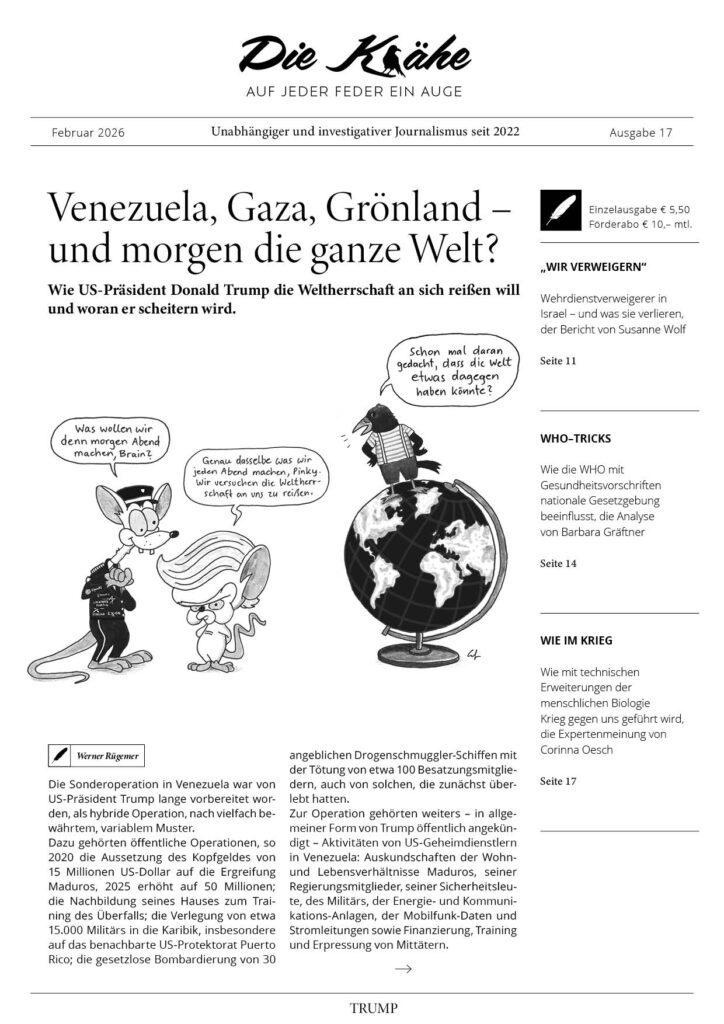
- „Wir verweigern“
Wehrdienstverweigerer in Israel – und was
sie verlieren, der Bericht von Susanne Wolf
- WHO–Tricks
Wie die WHO mit Gesundheitsvorschriften
nationale Gesetzgebung beeinflusst, die Analyse
von Barbara Gräftner
- Wie im Krieg
Wie mit technischen Erweiterungen der menschlichen Biologie
Krieg gegen uns geführt wird, die Expertenmeinung von
Corinna Oesch
Probelesen
Hier können Sie die erste Ausgabe von Die Krähe vom November 2022 kostenlos durchblättern und lesen.